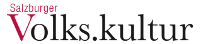

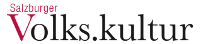

Aus eigener Kindheits- und Jugenderfahrung berichtet der Autor über das vorindustrielle Leben auf Lungauer Almen.
Um es gleich klarzustellen: Man geht „in die Alm”, nicht auf die Alm, und dann lebt oder arbeitet man nicht auf der Alm, sondern „in der Alm”. Im Lungau wenigstens. In Bayern, zwischen Ruhpolding und Reit im Winkl, liegen die Almen in einer Seehöhe um 800 Meter. Im Lungau aber liegt fast der ganze Bezirk über 1.000 Meter. Alles taugliche Land ist längst urbar gemacht und die Almen, die nun einmal zur bergbäuerlichen Wirtschaft gehören, liegen in den hinteren Winkeln der Seitentäler: im Rieding- und Murwinkel, im Twenger, Weißpriacher oder Göriacher Lanschfeld, in der Lanschitz und in der Lessacher oder Kendlbrucker Hinteralm (alle in Seehöhen von 1.300 bis gegen 2.500 Meter). Sie sind also fast immer „hintndrein” (drinnen) in irgendeinem Winkel. „In”, nicht „auf”.
Noch zwei ausgesprochene Almtäler vereinigen sich in Bundschuh, Gemeinde Thomatal: von Südwesten die „Weißseitn” und von Südosten die „Feldseitn” (neuerdings hat sich durch den Fremdenverkehr der Name „Schönfeld” eingebürgert.) Mit dem Talschluss der Rosanin bildet dieses vom Großen Königstuhl (2.336 Meter) ausgehende Tal die südlichste Ecke des Landes Salzburg. Die Berge der Gegend haben oft große Hochflächen (Schwarzwand, Mühlhauser Höhe u. a., mit einigen Seen), fallen nach Süden und Westen meist mäßig steil ab, haben aber – als Folge der Eiszeit – im Norden und Osten schroffe, felsdurchsetzte Steilhänge und Kare. Erst durch den aufkommenden Schi-Tourismus erfuhren wir, dass wir zum „Nockgebiet” gehören. Aber die Gegend ist auch heute erst wenig „technisch erschlossen” (am meisten um Innerkrems), bildet aber ein unerschöpfliches Gelände für Tourengeher und Wanderer.
In dieser „Feldseitn” gehören die meisten Almen zu Höfen in der Gemeinde Unternberg: Jocham, „Noimoa” (Neumaier), Trinker, Davidl, früher auch noch Doppelbauer, Doppler und Wirt – und schließlich die Alm meines Elternhauses, die Schilcheralm, mit der Almfläche zwischen 1.700 und fast 2.300 Meter Höhe und mit der Hütte, der höchstgelegenen des Tales, in 1.900 Meter. Damit steht die Hütte in der Kampfzone des Waldes, also zwischen Wald- und Baumgrenze. In diesem Almgebiet ist der Wald durch die Jahrhunderte lange Beweidung ohnehin stark aufgelockert. Die Mähder (einmahdige Wiesen, die nur einmal im Jahr gemäht werden können) und baumfreien Weideflächen sind wohl hauptsächlich durch Schwenden (Abmähen oder Ausreißen der jungen Holzpflanzen) entstanden, sind aber immer noch mit Baumgruppen und Einzelbäumen durchsetzt. (Im Almbereich zu roden, das heißt Baumwurzeln auszugraben, wäre nie sinnvoll gewesen.) Wenig genutzte Flächen wachsen sogar wieder zu, besonders mit Grünerlen, Zirben, Lärchen und Fichten.
In unserem Fall liegen unterhalb der Hütte zwei „Håltn” (eingezäunte Weiden für Kälber bzw. Jungstiere) und der Großteil des Mahdes. In der Jugendzeit unseres Vaters (um 1900) wurde jedoch noch bis auf eine Höhe von 2.100 Meter gemäht. Ich war wahrscheinlich vier Jahre alt (geb. 1924), als ich das erste Mal in die Alm mitgenommen wurde. Fünf Stunden Fußweg, aber als Kind durfte ich ja „reitn” (auf dem Wagen aufsitzen); nur bei größeren Steigungen hieß es absteigen und gehen, das galt vor allem für die letzten 200 Meter Höhenunterschied vom „Boden” (Talboden) hinauf zur Hütte. Was es da nun zu erforschen gab, war eine neue, andere Welt: Die Hütte, etwa sechs Meter breit und zehn Meter lang und nur ebenerdig, war mit ganz wenig Mörtel aus Feldsteinen aufgemauert und mit einem steilen Bretterdach gedeckt. Die traufseitige Tür, vor der noch der Brunnentrog plätscherte, führte direkt in die „Kuchl” mit dem offenen Herd, dessen Rauch frei durch das Dach abzog. In der Stube stand in einer Ecke ein runder, über und über mit Namen beschnitzter Tisch. An den Wänden hin eingezwängt, und im Stubentram [Tram; Tramen: Balken] waren noch gut die Buchstaben H S und die Jahreszahl 1814 zu erkennen. Bergseits befand sich der mit allerlei hölzernem Milchgeschirr ausgestattete dunkle, ebenerdige Keller, von dessen Wand man nur ein paar Steine wegräumen musste, um ins Freie zu gelangen (oder hinein!).
Aber dann war da noch der freistehende, ziemlich niedere Stall, angebaut der Saustall mit dem „Gleckathüttl” (Zufutter mit Grünanteil) im Obergeschoss und die Holzhütte, bei der das Holz von oben eingeworfen und von unten entnommen wurde. Über dem Misthaufen, an die Stallwand angelehnt, war ein offener Verschlag ohne Tür, das „Häusl” (Klosett). Schlafen durfte ich diesmal bei der „Sennden” (Sennerin) im einzigen Bett der Hütte, eben hinter dem Ofen in der Stube. Der „Hålter” (Kuhhirt) aber hatte sein Bett in einer Ecke über dem Kälberstall. Andere Schlafgelegenheiten gab es nur im Heu „auf'm Ståll”, also auf dem niederen und ziemlich engen Dach- und Heuboden des Stalles.
Allerdings änderte sich vieles, als unser Vater 1932 die Hütte zu einer Schihütte um- und ausbaute: die Mauern wurden verbessert, die Fenster vergrößert und der offene Herde natürlich durch einen Sparherd ersetzt. In einem oberen Stock wurden vier Zweibettzimmer mit eigenen Öfen eingerichtet, und im Unterdach hatten noch drei Lager mit insgesamt 15 Strohpritschen Platz. (Und die Gäste aus Graz, Wien, Linz, Prag und von überall her waren zufrieden, vergnügt und begeistert!).
1934 folgte noch ein Zubau, so dass nun 35 Leute unterkommen konnten. Im Sommer wurden jedoch keine Gäste angenommen, und so brachte der Umbau eine Reihe von Annehmlichkeiten, vor allem für die Sennerin und was das „Liegen” (Schlafen) betraf. Das größte Erlebnis war es, als mich Bruder Sepp mitnahm auf die „Heach” (Höhe). Wir gingen entlang von Steigen und „Wåssaloatn” (Bewässerungsgräben), vorbei an Quellen und großen Steinblöcken. Je höher wir stiegen, desto mehr weitete sich der Blick, zunächst auf Hochalmspitze und Hafner, dann auf die Radstädter und Schladminger Tauern, auf die Nockberge rundum, zu denen das Gebiet ja gehört, zum Zirbitzkogel und über Kärnten hinweg auf die Karawanken und Lienzer Dolomiten.
Vom „Stoa(n)mandl” sahen wir hinunter in die „Rossanie” (Rosanin-Alm), von den „Heachböden” (kleinere Gipfelplateaus des Ochsenriegel, 2.282 Meter) in die Hinteralm und ins Ochsenkar und vom „Nock” hinunter in die „Klealeng” (Klöling, heute Karneralm) und hinaus nach Tamsweg und Lessach. Am nächsten Tag gingen wir noch hinunter zur Rosaninhütte, denn mit „Ander” (Andreas), dem Senner, war Sepp nachbarschaftlich befreundet. Darum gab es auch zur Jause Butterbrot mit Honig, denn „Ander” hatte einige Bienenstöcke in der Nähe der Hütte.
In den nächsten paar Jahren durfte ich schon den Großteil des Sommers in der Alm bleiben und zwar als „Schottnudlhund”, das heißt als Ferienkind, dem aber schon immer mehr kleine Pflichten zuwuchsen: Feuer anblasen, Holz tragen, Kälber putzen und in ihre „Hålt” (eingezäunte Weidefläche) treiben bzw. von dort wieder holen, mitgehen und helfen beim täglichen „Gleckatgeahn” (Einsammeln von großblättrigen Pflanzen wie Alpendost [(Adenostyles) Korbblütler, Hochstaude in europäischen und kleinasiatischen Gebirgen, altrosa blühend] und Pestwurz [(Petasites) hellgelb, weißlich oder rötlich blühende Korbblütlergattung mit oft sehr großen, dreieckigen bis rundlichen Blättern, die erst nach der Blüte erscheinen], die dann fein gehackt, mit heißem Wasser übergossen und mit Salz und Kleie den Kühen gegeben wurden.). Gegen Ende des Sommers ging es noch ans „Schwåchzpöö-” und „Grantn-Brocken” (Heidel- und Preiselbeeren), Arnika und Speikwurzen [Speik: Valeriana celtica, verwandt dem Baldrian/Valeriana officinalis] sammeln oder beim „Graupenhaign” mithelfen (Zusammenkratzen von Isländischem Moos als Schweinefutter für den Winter). Im Herbst gab es als besonderen Leckerbissen die „Zeischgn” (Zirbenzapfen), deren Kerne etwas mühsam aufzubeißen sind, deren Samen aber vorzüglich schmecken.
Ein paar Sommer lang durfte ich dort und da mitgehen und wurde in verschiedene Aufgaben eingeführt, aber dann, mit neun oder zehn Jahren, begann die erste Pflichtübung: Ich wurde „Gåltachhålter” (Hirte des Jungviehs). Wir hatten (und haben noch) hinter dem Berg, im „Kühkar” der Hinteralm ein Weiderecht für 15 Stück „Gåltach” (Galtvieh = Kalbinnen und Ochsen). Und dieses Vieh musste ja „g'håltn” (gehütet) werden, denn es gab keine Zäune zu den Nachbaralmen und es lockte das gute Gras in den absturzgefährlichen Steilrinnen des Ochsenkars und der Hagleiten.
Damit allein war es aber nicht getan. Der durchschnittliche Tagesablauf begann um etwa vier Uhr mit dem Ausmisten, während „Sennden” und „Hålter” beim Melken waren. Danach hatte ich die Kühe „auszutreiben” bis ins Kar (gegen 2.100 Meter) und nach der Rückkehr das „Stållraama” (Ausmisten) zu beenden. Wenn alles gut ging, gab es gegen sieben Uhr die „Suppn” (Frühstück, bestehend aus Milchsuppe und „Kooch”, einem dicken Brei aus Milch, Mehl und Polenta mit reichlich Butter). Oft waren noch kleine Handgriffe um die Hütte zu erledigen, aber dann wurde die „Jausn” für das Mittagessen eingepackt: ein Stück Brot, dazu etwas Graukäse und Butter, die zum Frischhalten in „Blotschn” (Ampferblätter) eingewickelt wurden. Nur ganz selten erhielten wir statt Käse und Butter ein Stück Speck.
Nun ging es also los: hinauf durch die Alm auf fast 2.200 Meter, um den Berg herum und drüben hinunter, mit dem Lockruf „Buzei, Buzei” das Vieh suchen und zusammentreiben und auf geeignete Plätze hinlenken. Daneben gab es kleinere Arbeiten mit dem Wasser, Abräumen von Steinen und Verteilen der Kuhfladen oder das Austeilen von Salz und Kleie. Einmal baute ich mir auch an einer Felsrippe ein kleines „Håltahüttl”, einen Unterstand fürs ärgste Wetter, in dem man wohl zu zweit sitzen, aber nicht aufrecht stehen konnte. Dabei war ich fast die ganze Zeit allein, nur selten traf ich einen der Nachbarhalter. Wir neckten uns gerne mit dem Spruch, zum Beispiel: „Båcha Haitau, koa(n) Tüttl und koa(n) Aitan, wia weanega a Müch!” (Kleiner Halter vom Bacher, hat keine Zitze und kein Euter und schon recht keine Milch.). Wir erprobten gegenseitig unsere „Goasln” (Peitschen). Am Ende des Stiels musste ein Ring und ein Kreuz eingeschnitzt sein, sonst hieß es: „Koa(n) Kreuz und koa(n) Ring, schmeiß i dir'n so weit as i'hn bring”. Natürlich unterhielten wir uns über unsere Arbeit, das Vieh, die Hütten, die „Senndena” und die Kost, oder über die Nachbarn. Wenn's passte, sangen wir wohl auch einen Jodler oder ein Lied. Aber auf einmal hieß es: „So, åber hiaz muaß i wieda za meine Viecha schaun” – und weg war der Besuch.
Je nach Wetter, etwa um drei oder auch erst um fünf war es dann Zeit zum „Åbloatn”: das Vieh wurde hinunter getrieben auf sichere Plätze „im Holz” (innerhalb der Waldgrenze, um 1.700 bis 1.800 Meter), damit es zum nächsten Morgen nicht in die Gefahrenzonen oder über die Grenzen kam. Nun nur noch ein paar gute Worte zu den „Buzala” (Jungvieh) und zurück über die „Heach” (Höhe, Gipfelregion) und hinunter, heim zur Hütte. (Wenn wir in der Alm von „hoam” = heim redeten, meinten wir die Hütte; erst von der Hütte aus galt „hoam”, „hoam außi” oder „dahoam” für draußen beim „Haus” = Hof im Dorf.). Nach der Melkzeit wieder Kühe austreiben, ausmisten, Abendessen und bei einbrechender Nacht die Kühe von der „Åbndwoad” (Abendweide) in den Stall bringen. Eine tägliche Pflicht war noch das „Stållbetn” (Abendgebet im Stall mit Segen für das Vieh).
Soweit das freie, fröhliche Hirtenleben – aber das bei jedem Wetter! Es konnte oft so heiß werden, dass die Tiere in allen Richtungen vor den Dasselfliegen [(Biesfliegen, Oestridae) Familie großer behaarter Fliegen, Säugetierparasiten] und Bremsen davonrannten. Und es gab keinen Monat, in dem es nicht bis auf 2.000 Meter oder ganz auf den „Bodn” (Talboden) herunterschneien („åchaschneibm”) konnte. Und dann geh als 10- oder 12-jähriger „Stopstl” in Nebel und Wind bei knietiefem Schnee über die „Heach”, such deine „Viecha” zusammen und bring sie unterhalb der Schneegrenze in Sicherheit und geh halt den ganzen Weg wieder zurück, heim zur Hütte! Manchmal kam aber auch dazu, dass ich noch mit „Hålter” und „Sennden” die Pferde und das „Gåltach” auf der etwas unübersichtlichen Kuhalm zusammensuchen und unter Dach bringen musste.
Eine besondere Schwierigkeit war dabei noch die Kleidung. Wir hatten für den ganzen Sommer eigentlich nur unser Werktagsgewand und kaum etwas zum Wechseln oder für die Sonntage. Für das grobe Wetter gab es vielleicht einen Umhang oder einen alten Mantel und statt der kurzen „häutern' Hosn” (Lederhose) eine „löderne (Lodenhose). Irgendwie ging wieder alles; aber die durchnässten Röcke, die wir am Abend über den Herd hängten, waren auch den nächsten Morgen immer noch feucht.
Vollends ins Almleben eintauchen, konnte ich mit 15 und 16 (und später nach dem Krieg), als ich „Hålter” (Kuhhirt) wurde. So war ich nun zuständig für etwa zwölf Kühe und den Stier, einige Pferde und das größere Galtvieh, 8–10 Stück, darunter meistens einige Stück „Aufnehmviech” von anderen Bauern, die dann ihren Weidezins durch Mitarbeit im „Måhd” abdienten.
In den Lungauer Almen ist eigentlich die „Sennden” der Chef, vor allem soweit es um den Ertrag an Butter und Käse geht; aber für den Weidebetrieb, alle Außenarbeiten und so manche Hilfen in der Hütte ist der „Hålter” zuständig. Man ist ja miteinander auf sich selbst angewiesen, daher ist eine gute Zusammenarbeit besonders wichtig, ja entscheidend. Erfahrene Almleute wussten sich auch bei Geburten und Viehkrankheiten zu helfen. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein überliefertes Heilverfahren, als eine Kuh die „Maukn” hatte (Entzündung am Klauenrand). Wir holten die Kuh vor Sonnenaufgang aus dem Stall, stellten sie mit dem kranken Bein auf einen „Wåsn” (Rasenstück), stachen den „Wåsn” mit einem Messer aus und steckten ihn während eines bestimmten Gebetsspruches auf die Spitze des höchsten Zaunsteckens in der Nähe. Und das „Wåsnstechn” half: die Kuh wurde gesund!
Der Tagesablauf begann nun mit dem Melken – Melkmaschinen gab es auf Almen erst ab dem Sechziger- und Siebzigerjahren. Als nächstes kam das Milch- „Åchadrahn” (mit der Zentrifuge entrahmen); auf anderen Almen sah ich noch, wie die Milch in flachen „Stötzen” abgestellt wurde, so dass man am nächsten Tag den oben schwimmenden Rahm mit dem „Rahmzweck” (Span, breite Holzpalette) abschöpfen konnte. Je nach anfallender Menge wurde zwei- oder dreimal in der Woche der leicht angesäuerte Rahm in „der” Rührkübel zu Butter verrührt, eine der Arbeiten des Halters. Von der Magermilch wurde einiges an die Kälber und „Saudla” (Jungschweine) verfüttert, der Großteil kam aber in die große „Milchfrentn”, wurde dort sauer und dick und konnte zu Topfen und weiter zu Graukäse oder zum Teil zu „Reastkaas” (Röstkäse, ein Schmelzkäse) verarbeitet werden. Das „Kaawåssa” (Molke, wie in Tirol auch „Juttn” genannt) und die „Rührmilch” (Buttermilch) wurden nochmals erwärmt, wodurch der „Schottn” ausgefällt wurde. „Topfn” und „Schottn” wurden jeweils in ein Tuch eingeschlagen und in der „Schottwiagn” ausgepresst. Erst das letzte „Kaawåssa” diente schließlich als „Saufuatta”.
Nach der „Suppm” ging's hinauf ins Kar zu den Kühen, bei schönem Wetter hütete ich sie weiter bis auf die „Heach”, damit sie im kühlen Wind liegen und wiederkäuen konnten und vom „Fliagl” (der Dasselfliege) einigermaßen Ruhe hatten. Das gab wieder Zeit, bei den „Roos” (Pferden) und dem Galtvieh nachzusehen. Längere Pausen konnte ich nutzen, um Zäune und Wege instand zu setzen, Quelltränken frei zu machen oder Uferanrisse an den Bächen abzusichern. (Nicht zufällig arbeitete ich später mit großer Begeisterung bei der Wildbach- und Lawinenverbauung). Hier eine kleine Besonderheit am Rande: der „Noimoa-Gråbm” (Grenzbach zu unserer Nachbaralm), der unten auf einem flachen Schwemmkegel ausläuft, wurde zur Bewässerung auf das eine oder andere Mahd abgeleitet. So konnten wir selbst entscheiden, ob wir zum Einzugsgebiet der Lieser und Drau (Kremsbach) oder zu dem der Mur (Bundschuhbach) gehörten.
Ein- oder sogar zweimal im Jahr, wenn die Kühe ruhig grasten und lagerten, konnte ich es mir einteilen, dass ich über die Rosaninhöhe und den Mühlbacher Nock auf den Großen Königstuhl gehen und rennen konnte (hin und zurück je zwei Stunden). Aber sonst kam ich kaum über den Bereich der eigenen Alm hinaus – mit einer Ausnahme: Wir hatten so gegen 30 Schafe, und diese Steppentiere hielten sich an keine Grenzen. Zwei Tage blieben sie vielleicht in der eigenen Alm, aber auf einmal waren sie verschwunden, irgendwohin. Also hieß es alle paar Wochen: „Werst müassn Schoof suachn geahn!” So erkundete ich also das Trattnerkar (Ursprung des Kendlbrucker Grabens) und kam auf der Kärntner Seite bis ins Karlbad und zur Saureggalm. Auf unserem Höhenzug rannte ich bis zur Schönalm; in anderer Richtung über den kleinen Königstuhl (2.254 Meter) bis zur Mislitzalm, wo ich aber übernachtete, denn der Rückweg war einfach zu weit. Oft musste ich gestehen: „nix gseachn” (nichts gesehen); aber dann kamen sie wieder von selbst zurück. Einmal freilich fanden wir sie erst im November, nachdem sie schon eine Woche eingeschneit waren.
So war, wenigstens für mich, die ganze Almarbeit hauptsächlich Beinarbeit. Und das schon recht, wenn es manchmal notwendig war, „dahoam daußt”, also draußen im Dorf, eine dringende Post auszurichten, etwas abzuholen oder abzuliefern. Das bedeutete nun 25 Kilometer hinaus (war auch in drei Stunden zu machen), die Sache erledigen, im Garten ein paar Ribiseln abzupfen, einen Krapfen einstecken und 25 Kilometer bergwärts zurück! Leichter und schneller ging es noch, wenn ich einmal in Tamsweg oder Bundschuh bei einem lieben Dirndl einen Besuch machen konnte (wohl erst nach dem Krieg). Trotz solcher seltenen Ereignisse war die Almarbeit aber für die meisten einsam und eintönig; Tag für Tag das Gleiche! Kein Wunder also, dass manche von uns, vor allem von den länger dienenden, zu leut(e)scheuen Einsiedlern und Eigenbrötlern wurden. Aber es gab doch auch Abwechslung:
Der Höhepunkt des Almsommers war gewiss die Mahdzeit, wenn das ganze Gesinde des Hauses (= Hofes; gemeint ist das gesamte Hauswesen, das seit dem Mittelalter auch „das ganze Haus” hieß) für etwa drei Wochen „ins Måhd” kam, um Heu zu machen für den Winter. Die Anreise begann am ersten „Måhdsunntåg” (letzter Sonntag im Juli) mit einer fröhlichen Einkehr beim Bundschuher Wirt. Man traf und unterhielt sich ausgiebig bei Tanz und Gesang, denn zu den Almen beider Täler waren Dutzende Mahdleute unterwegs. Viele machten erst um Mitternacht Schluss, aber um vier Uhr rauschten schon die Sensen durch das saftige Almgras.
Es gab ja nur die Handarbeit, aber die war nach jahrelanger Erfahrung klaglos organisiert. 4–6 „Måhder” arbeiteten sich auf einem „Stoaß” (Stoß), einem gut 50 Meter breiten Streifen, über den Hang hinauf. Gegen sechs Uhr kamen die „Weiberleut” mit der „Suppm” nach, die nicht von der Sennden, sondern von der „Moadirn” gekocht war: immer Milchsuppe und „Topfenmuas” (ein Schmarren mit wenig Eiern, aber viel Topfen und Butter). Nachher war es die Arbeit der „Weiber”, das Gras auszubreiten („o(n)straan” = anstreuen). Wo es schütter ausfiel, wurde es auf „Scheibm” (schmale Streifen) zusammengeheut; je nach Gelände konnten auch „Bamscheibm” (verzweigte Streifen) angelegt werden.
Für die Männer dauerte es ein paar Stunden, bis sie sich oben zum „Stoaßåbråstn” hinsetzen konnten. Wenn die Rechten beisammen waren, wurde gesungen und gejodelt; sehr oft kam es zum „Riggla-Feiln”: „Riggla” sind die noch nicht „o(n)gstraatn” Mähschwaden, denn zwangsläufig blieben die Mädchen etwas hinten. Und das „Feiln”, bei dem man mit dem Wetzstein über den Rand der Sense kratzte, ergab ein fürchterliches, laut kreischendes Geräusch. Es folgte dazu vielleicht noch der Spruch: „Stoaß åb, Zipf åb, Zsåmmhaigarenna håm ma ah amål g'håbb. Dö Scheibm håm ma auf die Bam auffitriebn, dö Zsåmmhaigarenna send hintnbliebm.”
Wenn Nachbar-„Måhda” in Rufnähe waren, wurden auch diese „tratzt”: „Dö Bernhåchtn- Måhda, da hinta und da ‚våda' (vordere), an iada an groaßn Bauch – fressn viel, åba mahn rauch (rau)”: Doch da konnte die Antwort kommen: „Håps (habt ihr) an ‚Humma' (Hunger) – kemps umma (kommt herüber)‚Koiwappm' åbleckn (das Schmalz vom Kinn abschlecken)!” Auf fette Kost wurde immer viel Wert gelegt.
Nach einem Tag oder zweien konnte am Nachmittag mit dem Heuen begonnen werden. Der „Gåltachhålter” hatte dazu zwei oder drei Zugtiere (Pferde, auch Ochsen) von der Alm zu bringen (ein Hin- und Herweg mehr!). Die Männer waren für das Beladen der „Hoaschgln” (große flache Schlitten mit dicken Brettern als Kufen) und für das Abladen zuständig. Die „Weiberleut” schoben das Heu der „Scheibm” auf große Haufen zusammen und besorgten das „Nåchhaign” und „Fuader-Åbhaign”, damit kein Heu auf der schwierigen Fahrt verloren ging. Das meiste Heu wurde in einem Stadel für den Abtransport im Winter eingelagert, nur ein kleiner Teil musste mit einem Karren oder auf dem Rücken „auf'n Ståll” gebracht werden, als Notfutter für Schneetage.
Mehr Geselligkeit als in der Zusammenarbeit beim Heuen gab es dann am Abend in der Hütte. Nach dem „Nåchtmahl” (Abendessen, meist „Schottnudel” = Laibchen aus Topfenteig, selten Knödel) saß man noch in der Stube oder vor der Hütte beisammen, unterhielt sich locker oder erzählte Geschichten. War einer dabei mit einem „Fotzhobel” (Mundharmonika), einer Zither oder gar mit einer „Harmoni” (diatonische Harmonika), dann wurde auch getanzt und gesungen. Und es konnte spät werden, bis sich alle im Heu bzw. auf dem Lager verkrochen; aber streng getrennt nach der „Weiberleut- und der Mannerleut-Seitn” – Liebschaften innerhalb der Hausgemeinschaft waren streng verpönt! Die Nächte wurden meist sehr kurz, aber in der Höhenluft schäumten wir über vor Lebenslust! (Freilich gab es auch die, die in allem nur die Plage sahen).
Wenn nicht die Heuarbeit vordringlich war, konnten wir am Sonntag „heachgeahn”: über die Alm hinauf zur Höhe, also zu den Gipfeln wandern, Blumen und Wässer bewundern, das Vieh begutachten und vor allem die Aussicht genießen und im Höhenwind ein wenig in der Sonne liegen. Zum „zweiten Måhdsonntag” gingen wir nachmittags noch einmal nach Bundschuh und am dritten zur „Mehrlhüttn”, der Dr.- Josef-Mehrl-Hütte des Alpenvereins, die 1936 neu erbaut worden war und wo wir uns auch mit unseren Kärntner Nachbarn trafen – wieder mit viel Singen und Tanzen. Und immer wieder schallten „Juschgaza” (Juchschreie, als Ankündigung oder Ausdruck der Freude) durch das Tal. Übrigens: In der Fachliteratur liest man von einem allgemeinen Tanzverbot, so lange das Getreide noch „auf dem Halm” steht. In den Lungau ist dieses Verbot – zumindest im 20. Jahrhundert. – nicht durchgedrungen.
Gegen Ende der Mahdzeit gab es noch andere Arbeiten wie Wege und Zäune ausbessern, Brennholz machen, Gewand flicken und vor allem Mistführen, dies besonders an Regen- und Schneetagen, wo auch Reparaturen an Gebäuden und Geräten durchgeführt wurden – man sprach von „Pograt-Geign”. Aber einmal, etwa um den „Hoachfrau(n)tåg” (15. August, Mariae Himmelfahrt) kam für die „Lait” (Hausleute) der Abschied, und wir Almleute waren wieder für uns allein. Doch gerade im Nachsommer gab es dann und wann Besuche von Verwandten, Nachbarn und Freunden und man sagte noch, sie gehen „Jåggasn”, obwohl der Jåggas-(Jakobs)tag, 25. Juli, ja in die Mahdzeit gefallen war. „Jåggaser” brachten meistens Geschenke mit, besonders Kaffee und Zucker, und erhielten dafür eine besondere Jause: Milch in verschiedener Art nach Wahl, zum Brot „a Moasn”, ein mit Modeln verziertes Stück Butter (zu slawisch maslo) und dann vor allem ein „Rahmkoch” (mit Rahm zu großen Bröseln geriebenes Mehl, das mit Zucker und Weinbeeren in Butterfett gekocht wird; eine Art Sulz bzw. Pudding); im warmen Zustand bringt man es kaum „aus'm Mäu” (Mund), aber kalt ist es eine hervorragende Köstlichkeit und Kraftnahrung. Scherzeshalber erzählt man sich, wie eine junge „Sennden” ihren Lehrer auf Hochdeutsch zum „Jåggasn” eingeladen habe: „Wenn Sie zu mir jaggaisen kommen, kriegen Sie Riemenköch, Schattenniedel und eine Maise”.
Gegen den Herbst zu kamen noch andere Besucher: „Wuchzngråba”, die Wurzeln von Enzian (gelber Enzian, Gentiana lutea, der zur Schnapsherstellung verwendet wird) und Speik (zur Parfum- und Seifenerzeugung begehrt) sammelten und sie dabei leider weitgehend ausrotteten; „Schmålzbettler”, das heißt arme Leute, die sich ein wenig Butter erbaten (von der Alm wurde nichts verkauft!). Dann „Zeischgngarber”, die oft Säcke voll von Zirbenzapfen pflückten und aufhoben (die Kerne zum Einlegen in Schnaps; die Zapfen als Brennmaterial); Oder es ging „der Korb” (Korbinian, ein Nachbarsknecht) mit seinem großen Grammophon von Hütte zu Hütte und spielte den Sennerinnen seine Platten vor.
Man wird fragen: „Und was war mit Jägern und Wildschützen?” Antwort: „Nix!” Die meisten Almen waren zu klein für Eigenjagden und diese waren meist verpachtet. Und das Wild war ja rar: Im „Gompåltarach” (Grünerlenflächen) hatte vielleicht ein Rehbock seinen Einstand; weit oben nahmen die „Manggala” (Murmeltiere) allmählich überhand. Im felsigen Gelände gab es ab und zu einige Gams, und das Rotwild stieg erst in der Brunft aus den Wäldern der Fürst Schwarzenberg'schen Reviere herauf und zog dann wohl auch noch im Winter über die Höhen. Allgemein wurde das Wild bestimmt vom Weidevieh verdrängt, äste dann aber umso lieber auf den freien Flächen, besonders den Mähdern. Zur Vollständigkeit: es gab natürlich auch Auer- (wenig), Birk- (etwas mehr) und Schneehühner (ziemlich viele), dazu Schneehasen, aber die alle wurden auf den Almen kaum bejagt – und schon recht nicht im Sommer.
„Kloa(n)frau(n)tåg” (8. September, Mariä Geburt) war der Termin, an dem das „Måhdlåssn” begann: die Kühe durften in die zum Teil eingezäunten Mähder eingetrieben werden. Häufiger Reif am Morgen brachte auch späteres Auslassen, und als „Hålta” musste ich nicht mehr so viel über die Alm rennen, sondern mit einem Ochsen-Zwiegespann und einer Strauchegge tagelang den Mist anreiben („Mist- Ånpauschn”). Die Nachbarsennerinnen hatten nun Zeit, sich gegenseitig zum „Teesiadn” zu besuchen, und abends machten wir es uns gemütlich mit „Fuchsjågn” (Fuchs und Henne), „Mühlfåhrn” (Mühle) oder Kartenspielen. Fast jeden Herbst gab es in Bundschuh auch einen „Senndenball”: von den vielen Almen kamen die Sennerinnen und Halter und aus den Dörfern noch mehr als genug Tänzer.
Zu den letzten Arbeiten gehörte das Ablegen der Zäune, damit sie nicht durch den Schnee beschädigt wurden. Allerdings musste ich um diese Zeit meistens schon fort in die Schule. Nur in den Jahren nach dem Krieg konnte ich bleiben bis zum „Aus-der-Ålm-Fåhrn”, das je nach Wetter auf einen der ersten Samstage im Oktober (Goldene Samstage) angesetzt war.
Am Vortag des großen Ereignisses kamen Vater und ein Knecht, um beim „Aufkaasn”, dem Verarbeiten der letzten Milchmengen, zu helfen und die Käse und die mit Modeln und Preiselbeeren besonders schön verzierte „Butterfrentn” (ein Schaff – Gefäß -, etwa 80 cm hoch und mit 50 cm Durchmesser) zum Verladen vorzubereiten. Wir hatten schon Tage zuvor Zirbenzweige und „Grantnbromlach” (Preiselbeersträucher) vorbereitet und mit Papierblumen geschmückt. Die Kälber bekamen davon zarte Kränze um den Hals, alle größeren Rinder einen Stirnkranz von Horn zu Horn. Die „Gloggnkuah” behielt ihre „Zigiassn” (eine gegossene Messingglocke), aber die schönste und wohl auch stärkste Kuh erhielt an einem breiten Riemen die große, blechgeschmiedete „Tuschgloggn”, deren Schall durch das ganze Tal dröhnen konnte. Der Stier hatte auf einem kleinen Joch seinen „Stiapåchzn”, einen etwa meterhohen Zirbenwipfel, zu tragen. So zogen wir nun mit der ganzen Herde (aber ohne Pferde, Schweine und Schafe) talaus, und vor dem ersten Dorf wurde erst die „Kranzkuah” richtig „aufbüscht”, das heißt sie bekam einen breiten Stirnfleck mit einem Spiegel, übergroße Scheiden auf die Hörner und eine Art Umhang über den Hals, alles mit Gold- und Silberflitter geziert. Allerdings: wenn sich in der Alm oder beim „Haus” (= daheim) ein Todesfall bei Mensch oder Vieh ereignet hätte, wäre nicht „aufkranzt” worden.
So ging es dann, ich als Hålter mit Gloggnkuah und Stier voran, durch Pichlern und Pischelsdorf, wo auf den Klang der „Tuschgloggn” und auf meine „Juschgaza” hin schon die Leute aus den Häusern traten, grüßten und schauten. Vor Unternberg, unserem Dorf, empfingen uns drei „Klöcker” mit ihren „Tuschgoasln” (entsprechend den Peitschen der Aperschnalzer). Die „Sennden”, die hinten beim Vater auf dem Wagen mitgefahren war, stieg in jedem Dorf aus und beschenkte die Zuschauer mit „Schnuraus” (schon vorher im Haus gebackene, gut nussgroße Stücke aus einem krapfenähnlichen Buttermürb-Teig mit Zimtzucker).
Endlich vor dem Haus angekommen wurden wir von Mutter empfangen und mit Weihwasser besprengt. Der schöne Kuhkranz und der Stier-„Påchzn” wurden abgenommen, das Vieh durfte sich auf einem nahen Feld vom weiten Marsch erholen. Im Ganzen war es ein Fest und Festzug, gewissermaßen die Erntedankprozession des Almbauern. Der Almsommer war damit zu Ende, nicht aber die Arbeit mit dem Vieh und den Erträgnissen. (Ein später nachfolgender „Ålminger-Tanz” wie in Tirol oder der Hüatertanz in der Gastein ist mir vom Lungau nicht bekannt, wohl aber gibt es fast jedes Jahr Almleute-Ehrungen.). Wir ruhten uns nur aus, dankten still und freuten uns auf das nächste „Ålmfåhren. Übrigens „pflegten” wir bei dem allem keine „Bräuche”, wir taten nur alles so wie des „der Brauch” war, aber das brauchten wir, damit wir gut durch das Jahr kamen.
In ein paar Urlauben im Krieg konnte ich noch andere Herbst- und Winterarbeiten probieren: „Laabhaign” und „Straageahn” (Laub- und Nadelstreu gewinnen), Heu führen aus der Alm, Mist führen und „Bergfåhrn” (Blochholz liefern vom Wald herunter). Aber als ich dann nach dem Krieg in Wien studieren konnte, galt jeder Sommer wieder der Alm. Überdies konnte ich nun auch in den Weihnachts- und Osterferien mit meinen Brüdern, Vettern und Freunden, dann auch mit Kollegen und Kolleginnen in der Hütte hausen. Durch meine Kenntnis der Gegend wusste ich die besten Anstiege mit schönsten Abfahrten, so wurden es gottvolle Schitage und fröhliche Abende in der Hütte. Auch hier wurde gesungen, getanzt und gespielt bis tief in die Nacht, wie beim „Måhdsunntåg” und „Senndenball”, einfach ganz almerisch. Um 1970 wurde die Hütte zweimal durch Lawinen schwer beschädigt, und da ein Neubau leichter zu finanzieren war als die Reparatur und eine Lawinenverbauung, wurde 50 Meter tiefer an einem sicheren Platz eine neue Hütte errichtet. Den lang bewährten, verlässlichen Almleuten Marie und Peter ist es zu verdanken, dass der Almbetrieb weiterläuft wie eh und je, wenn auch etwas eingeschränkt.
Für mich gilt, dass ich bei allem, was ich später noch an großen und freudigen, aber oft auch an sehr harten Erlebnissen durchmachen durfte, sagen muss, dass ich am meisten geprägt wurde durch den Krieg (aus dem ich ja lebend heimkam) und durch die Alm, immer wieder die Alm. Jahre später nahm ich in Klagenfurt an einer Volkskundetagung teil, bei der Hofrat Dr. Kurt Conrad, der Begründer des Salzburger Freilichtmuseums, ein hervorragendes Referat über die Geräte der Almwirtschaft hielt. Bei der Heimfahrt mit ihm und Frau Senatsrätin Dr. Friederike Prodinger kam das Gespräch natürlich auch auf die Almen. Und da erzählte Dr. Conrad, wie er bei seinen Erhebungen für den Alpkataster (um 1952) im Lungau einen so richtigen Bauernpatriarchen kennen gelernt habe, und dieser habe ihm über das Almleben erklärt: „Es ist hålt oa(n)fåch a Lebm gwösn, und wånns Himmöloch waar offn gwön, mia waarn koa(n) naachnd nid a(n)chegånga (um keinen Preis hineingegangen) ”. Es stellte sich bald heraus: der „Patriarch” war unser Vater gewesen – „treast'n Gott” (Gott hab ihn selig!). Und das wünscht das HerausgeberInnenteam auch unserem geschätzten Herrn OStR DI Karl Santner (20.10. 1924–6.10.2002) in ehrenvollem Angedenken. Er hat das Erscheinen dieser Arbeit leider nicht mehr erlebt. Auf seinem Sterbebild stand ein Spruch zu lesen, der ihn und seine Arbeit auf das Beste charakterisiert: „Ich will singen dem Herrn mein Leben lang, ich will loben meinen Gott so lang ich bin.”